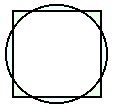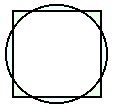- Die öffentliche Aufmerksamkeit und phasenweise Begeisterung des „Abendlandes" für Knüpf- und Weberzeugnisse aus dem Orient, dem „Morgenland", ist erst reichliche 100 oder knappe 150 Jahre alt.
1873 präsentierte Persien zur Weltausstellung in Wien eine Reihe erlesener handgeknüpfter Teppiche, die das Auge der Besucher und der Kunstkenner in ungeahnter Weise gefangen nahmen und das Märchen von Tausendundeiner Nacht neu aufleben ließen.
- Allerdings fand der Orientteppich auf dem Tausch- und Geschenkwege in Europa bereits seit der Renaissance seinen Platz und wurde als Decke und Wandbehang in den Häusern des Adels, der Patrizier, der Kirchen und – selbstverständlich – der Künstler benutzt.
Diese waren es sogar, die über die Darstellung auf ihren Gemälden einigen in der Kunstgeschichte und Ethnologie allgemein bekannten Teppichtypen ihren Namen gaben: dem Lotto-Teppich (nach Bernardo Lotto), dem Holbein-Teppich (nach Hans Holbein d. Ä.).
- Die genialen Erfindungen des Maschinenzeitalters im 19. Jahrhundert, die den Maschinenteppich in Europa salonfähig (im wahrsten Sinne!) gemacht hatten, verblassten angesichts der auf der Weltausstellung präsentierten orientalischen Pracht, die von unsagbarer handwerklicher Akribie zeugten (wofür leider in der Hauptsache das Kriterium der Knüpfdichte herangezogen wurde!) und zauberhafte, geheimnisvolle oder gar kryptische Musterung und verblüffende Farbgebung in sich trugen.
Bis heute hält sich der Mythos der angeblichen besonderen Begabung des Orientalen für die Farbe, und die Knüpfdichte ist beim Erwerb eines Teppichs für den bürgerlichen Haushalt weiterhin der Maßstab der Wertschätzung und der kommerziellen Veranschlagung für den Händler.
- Die Massennachfrage bestand zunächst nur für die geknüpften orientalischen Bodenteppiche, und hier fast ausschließlich für die in höfischen und städtischen Manufakturen hergestellten, und hier wiederum war es besonders der PERSER für das bürgerliche Eß- und Wohnzimmer.
Dieser kam der gängigen westlichen Auffassung von Farbharmonie nahe, und der Handel bediente – unsäglicherweise – sogar diesen Geschmack durch künstliches Bleichen von Teppichen anderer Provenienzen (z.B. entstand durch Bleichen der so genannte „Goldafghan").
- Doch einmal geschmacklich im Orient angekommen, gerieten für die einsetzende Mode der „orientalischen Ecke" des Herrenzimmers bald weitere Formate, und damit die auch diese Ausstellung tangierenden Objekte in Mode:
Kelimstreifen wurden zu Fenster- und Nischenvorhängen umfunktioniert, große Kelims, die so genannten Ochsenkarrendecken, bedeckten den Diwan, zusammen mit Poshtis, den Kissen in Knüpf- oder Flachtechnik.
- Der massenhaft einsetzende Bedarf trieb die europäischen Händler auf die Suche in bisher nicht einbezogene, auch weit entfernte Gebiete.
Aber auch in den Herstellungsgebieten reagierte man rasch auf die Nachfrage und zog den Erzeugern sozusagen die entstehenden Produkte unter den Fingern weg und brachte sie auf den Markt.
Schließlich wurden auch Erzeugnisse der bäuerlichen und Hirten- (Nomaden-)bevölkerung, die bisher nur für den Eigenbedarf gearbeitet hatte, in den Handelskreislauf einbezogen.
Überall, bis in die Gebiete Zentral- und Ostasiens, von Turkmenistan und Ostturkestan, entstanden Sammel- und Großhandelsplätze für die Importeure.
- In Europa waren es dann ausgerechnet die Erzeugnisse des bäuerlichen und Nomadenfleißes, die ob ihrer Billigkeit dem hemmungslosen Verschleiß und der Zweckentfremdung ausgesetzt waren.
So wurden beispielsweise die Vorderfronten der Taschen und Vorratsbehälter verschiedener Provenienzen, die wir in dieser Ausstellung bewundern können, zu Kissen vernäht als Zierde der schon erwähnten „orientalischen Ecke" der gutbürgerlichen Herren und zu Stuhlbezügen u.a. für die sonstige Wohnungseinrichtung.
Glücklicherweise stellten sich diesem kommerziellen Run, der zwangsweise auch zu einem Absinken der Qualität, vor allem aber der Originalität des Orientteppichs bei den Erzeugern führte, alsbald die Kunstwissenschaftler, die Ethnologen und in besonderer Weise der Sachverstand einzelner Sammler und Liebhaber entgegen, um zu retten, was zu retten war.
- Wilhelm Bode und Friedrich Sarre, die 1904 auf der Museumsinsel die Abteilung islamischer Kunst der Berliner Museen gründeten, bezogen den Teppich in die Aufgaben des Museums zur Bewahrung, Forschung und Rezeption, ein, zunächst jedoch fast ausschließlich die sozusagen auf den ersten Blick von hohem Kunstwert zeugenden höfischen und städtischen Exponate.
- Es waren einzelne Kunstinteressierte, Privatreisende, die mehr oder weniger zufällig mit Erzeugnissen des Bauern- und Hirtenfleißes in Berührung gekommen waren und deren Wert erkannten.
So leistete der russische Gouverneur Bogoljubow zu Anfang des 20. Jahrhunderts Pionierarbeit bei der Erfassung und Feldbeschreibung turkmenischer Teppiche.
Der Bremer Willi Gustav Rickmers sammelte zwischen 1894 und 98 auf seinen geobotanischen Reisen in den Orient u.a. 50 turkmenische Teppiche, die er dem Museum für Völkerkunde in Berlin überließ.
Auch die Kunstgewerbemuseen erhielten die ersten Anstöße von kunstinteressierten Laien.
- Dieser Rezeptionsweg, von der Wertschätzung des Sammlers oder Kunstkenners zur nachfolgenden Würdigung durch die Museen, ist auf dem Gebiet der Teppichforschung das Gängige gewesen und funktioniert vielfach auch heute noch so.
- Das Abendland hatte die Krise des Orientteppichs ausgelöst, leistete bald aber wie gesagt auch Erhebliches zu seiner Bewahrung und Erforschung.
Denn die Bestände der ethnologischen Museen des Orients sind gemeinhin dürftiger als anzunehmen.
Es dauerte aber auch in Europa und in Deutschland, insbesondere aufgrund der beiden Weltkriege, noch lange, viel zu lange!, bis eine systematische Feldforschung in den Ursprungsländern einsetzte.
- Inzwischen stapelten sich in den Oasenstädten bei den Wollfärbern die Fässer mit Industriefarben, deren sich auch die knüpfenden Bäuerinnen und Hirtenfrauen statt der alten, so bewundernswerten Pflanzenfarben bedienten (absurderweise nicht, wie man annehmen möchte, wegen der einfacheren Handhabung, sondern aus Bewunderung für den durch einfache Mischung möglich gewordenen vermeintlichen Farbreichtum!).
- Die Lebensbedingungen wie die Gesellschaftsordnungen hatten sich geändert und sie ändern sich immerfort. Die einstigen nomadisierenden Hirten sind teilweise oder gänzlich sesshaft geworden, und die Industrialisierung, die in die entlegensten Gebiete vordringt, hat die Notwendigkeit der Herstellung solcher Gebrauchsgegenstände, wie wir sie heute in der Sammlung Hummel sehen können, aufgehoben.
- Jedoch!! Der Gebrauch von geknüpftem, broschiertem und kunstvoll gewebtem Hausrat, Mobiliar und Reisebedarf kann nicht mit der Ermangelung industriell gefertigter Güter begründet werden. Wenn es n u r um das Aufbewahren der nötigen Gegenstände und Lebensmittel in den Zelten und das Transportieren auf den Wanderwegen gegangen wäre, hätten wir in unserer heutigen Ausstellung im Bauernmuseum wenig zu bestaunen.
Denn Behältnisse wären aus den verfügbaren Materialien, Wolle oder Ziegenhaar oder Baumwolle auch in einfacher Webart, z.B. in der auch in Europa seit jeher gängigen so genannten Leinwandbindung voll funktionsfähig herzustellen gewesen und sie wurden auch für den ganz gewöhnlichen Gebrauch auf diese Art gefertigt.
- Was wir in dieser Ausstellung zu sehen bekommen sind aber gerade äußerst kunstvolle Webtechniken.
Die Leinwandbindung kommt bei diesen Exponaten für die Rückwand zum Einsatz, die „Schauseite" zeigt Techniken, für die sich Begriffe wie Kelim, Soumakh, Verneh und Sileh eingebürgert haben (ich bin keine Fachfrau, Begriffe ändern sich, werden auch für verschiedene Provenienzen verschieden gebraucht).
Allen diesen Techniken gemeinsam ist die Musterbildung durch farbige Schussfäden über der im Gewebe unsichtbar verlaufenden einfarbigen Kette (einzig einige Schmuckbänder bilden Muster durch verschiedenfarbige Schussfäden).
- Man sagt – und Sie werden es bei der Betrachtung sofort glauben wollen – dass im Gegensatz zur mehr oder weniger erlernbaren Knüpftechnik (in der farbige Wollfäden in das Grundgewebe eingetragen werden) das Fertigen eines Flachgewebes sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen werden muss.
- Es gibt also ein zweites Moment, eine zweite und nicht unwesentliche Funktion dieser Objekte.
Diese ist dem Abendland keineswegs fremd, nur die Objekte sind andere: die Repräsentation, insbesondere im Zusammenhang mit den Ritualen und Zeremonien der Familien.
- „Je größer die Liebe der Braut desto schöner die Satteldecke für den Bräutigam" lautete ein Spruch bei den Turkmenen. Wie wir aus der eigenen Vergangenheit wissen, ist dies ein Sentiment, denn die Liebe war in früheren Zeiten weder im Orient noch im Okzident das entscheidende Kriterium für Eheschließungen.
- Aber die üppige und prachtvolle Aussteuer der Braut bewies doch deren Fleiß und Können, mehrte aber vor allem das Ansehen der Familie. Durch äußerst pfleglichen Gebrauch und die keineswegs alltägliche, sondern nur für besondere Anlässe vorgesehene Nutzung der Repräsentationsstücke wurden die Teppicherzeugnisse mit der Zeit zugleich zu einer Art Ahnentafel der Familien.
- Kriegerische Auseinandersetzungen unter den Sippen und Stämmen konnten auch fremdes „Erbgut" einbringen, das sich durch andere Musterung, andere Ornamentik, auch andere Materialverarbeitung auswies.
- Hier kommen wir zu einer dritten, dem Abendlande nicht oder zumindest nicht mehr geläufigen Funktion der Teppicherzeugnisse: der Einsatz der Ornamentik als eine Form der Sprache.
- Die Motive und ihre Verbindungen üben auf den Sammler und natürlich auf die Forschung den eigentlichen Reiz aus.
Den Reiz immer neuer Entdeckungen am einzelnen Objekt (z.B. die aus dem „horror vacui" entstandenen zauberhaften Füllornamente im Teppichfeld).
Den Reiz der Ungewöhnlichkeit, z.B. die perspektivische Ornamentierung bei den so genannten Gartenteppichen, oder verblüffende Kontextierung.
- Schließlich jedoch – das nicht Deutbare: die Motive des Animistisch-Religiösen, bei Turkmenenteppichen bis zur Reglementierung, zur Vorschrift gesteigerter Einsatz zur Musterung des Teppichs.
Motive und Musterbildung waren ein Ausweis der Stammeszugehörigkeit, und in diesem Rahmen wiederum erhielten einzelne Motive besondere Aufgaben, als Glücksbringer etwa und insbesondere zu Schutz und Abwehr des Negativen, den Erhalt der Familie und der Sippe Bedrohenden.
Die Abwehr des Bösen auf dem Schwellenteppich, auf dem Brustschmuck des Leitkamels, auf dem Zeltvorhang.
- Nur leider ist die Forschung mehr oder weniger auf Vermutungen und gewagte (bis waghalsige!) Deutungen und Abwägung widersprüchlicher Aussagen angewiesen. Die, wie schon angeführt, sehr spät einsetzende Feldforschung hat zum Einsatz bestimmter Motive und Zeichen nur noch in beschränktem Maße Aufklärung leisten können.
- Die Knüpferinnen waren zumeist dem Ursprung schon entrückt. Sie verwendeten zumeist eingebürgerte Arbeitsbezeichnungen.
Dietrich H. Wegener führt in einem Feldforschungsbericht ein Beispiel an: die Weberinnen bezeichneten ein von dessen Aussehen hergeleitetes Muster als „Wirbelsäulen – Göl".
Es ist aber das alte Temirdjin – Göl der Ersari das unter diesem Begriff weitergeknüpft wurde.
- Das Geschilderte belegt aber auch, dass es noch das spirituelle Bewusstsein, das Empfinden der Unantastbarkeit für bestimmte Motive gibt, und dass die Einhaltung der überkommenen „Vorschriften" noch im Blickfeld ist.
- Wegener beschreibt in seinem Feldforschungsbericht „Der Knüpfteppich bei den Belutshen und ihren Nachbarn" Ende der siebziger Jahre auch folgendes Phänomen: „Die Ali-Akbar-Khani-Belutshen … benutzten in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts zwei verschiedene Motive gleichzeitig.
Über den ursprünglichen Symbolwert dieser Motive war nichts zu erfahren.
Wenn sich von den ältesten Frauen einer Knüpfersippe, den Traditionsbewahrerinnen also, keine mehr recht an eine Bedeutung erinnern konnte, war die übliche Antwort „adat hast": „es ist so gebräuchlich, es schickt sich so".
- Aus unserer Kinderzeit erinnern wir uns vielleicht dieser kryptischen Argumentation der Erwachsenen: Warum muss ich das denn machen? – Weil es sich so gehört!
- Ist man über das Stadium jugendlicher Renitenz hinaus, wird man in dem „Es schickt sich so, es gehört sich so" nicht nur Muffigkeit oder Anachronismus, sondern auch Weisheit entdecken.
Die Beharrung, auch mit Zwang verbunden, ist die Grundlage des menschlichen Zusammenlebens, sei es die Familie, die Sippe, das Volk oder die globalisierte Welt. Sie ist die Konstante und gibt den sicheren Raum, in dem was getan wird, was zum Erhalt der Gemeinschaft getan werden muss.
- In der so genannten zivilisierten Welt regelt vorrangig der Staat über die Gesetzgebung die Normen des Zusammenlebens, in Europa de facto und national zeitversetzt also seit Napoleon! Und bis auf die Aufhebung bestimmter Diskriminierungen hat sich aus gutem Grunde im deutschen BGB nicht allzu viel geändert.
- Die soziale Ordnung nomadisierender Viehzüchter die mit dem Rhythmus der Jahreszeiten die Weideplätze für ihre Herden wechseln, der Turkmenen, der Belutschen beispielsweise, strukturierte sich im Groben folgendermaßen:
Man war Angehöriger einer Familie, mehrere Familien bildeten eine Untersippe, mehrere von diesen bilden eine Sippe, mehrere Sippen bilden den Stamm mit einem Stammesführer.
Dem autoritären Stammesführer unterstehen die Sippenführer.
Was sich schickt, was sich gehört, richtete sich nach dem ungeschriebenen Kodex des Stammes.
- Im Bereich des Alltäglichen hat sich vermeintlicher Fortschritt, das Aufgeben der Traditionen in Arbeit und Sitten, oft als zerstörerisch erwiesen.
Wie wir wissen, trifft das besonders auf Gruppen zu, die sich dem zivilisatorischen Sog beugen mussten, dem Druck des Stärkeren, der dem Schwächeren für das Aufgegebene jedoch keinen Ersatz bieten konnte und wollte.
- Ich betrete zum ersten Mal dieses schöne Bauerngerätemuseum. Werden wir nicht auch hier erinnert und zur Besinnung gerufen, dass Fortschritt unter Einsatz besten Erfindergeistes zwar den Hunger besiegen konnte (was selbstverständlich nicht wenig ist!) und Erleichterungen bei der schweren Arbeit des Bauern brachte, jedoch nicht das, was doch auch Streben und Sehnsucht ist: Zufriedenheit und Einssein mit dem Geschaffenen.
Statt dessen Konkurrenzangst, Überproduktion, Absatzschwierigkeiten, häufig einhergehend mit der Verschlechterung der Qualität der Produkte.
- Das unstete Leben der Sippen und Stämme, deren textile Erzeugnisse wir hier bewundern können, war alles andere als idyllisch, vielmehr von ständigen Sorgen um den Erhalt der Herden als Lebensgrundlage und auch von zahllosen kriegerischen Auseinandersetzungen geprägt.
Wie viel mag es da bedeutet haben, dass Frauenhände neben dem Notwendigen und dem Nützlichen auch Schönheit und Vertrautheit für das Zelt, für den kleinen mobilen Raum, der sie zusammenhielt, schufen und Geborgenheit auf den Wanderungen durch die Weite ihres Lebensraums.
- Man hat in der Erforschung dieses empfindlichen, vergänglichen Objekts, des orientalischen Teppichs, vieles rekonstruieren können, viel Wissen um die Dinge erworben und viel spekuliert. Die These, dass bei der Einteilung des Teppichs in Feld und Bordüre das Feld einen Ausschnitt aus der Unendlichkeit darstellen sollte, ist durchaus nachvollziehbar.
Oder dass das rote Glühen der Turkmenenteppiche der Kontrapunkt gegen die farbliche Armut der Nomadenwelt war.
- Beim Betrachten der hier versammelten Dinge aus dem Leben verschiedener Hirtenstämme des Orients drängt sich mir e i n Gedanke, e i n e Gewissheit auf (meine Damen und Herren, gerade für diesen Abschluss meiner Ausführungen fehlen mir die schlüssigen Formulierungen, sehen Sie es mir nach, ich meine ungefähr Folgendes:):
- Wie auch immer gestaltet,
- diese Schöpfungen sind in ihrem Entstehungsfeld
- der einzig mögliche und der gegebene Ausdruck von I d e n t i t ä t.
- Sie sind die Reproduktion des Ich
- in der Reproduktion des Kosmos.
- Einführung in die Ausstellung bei der Eröffnung am 9. Juli 2006 durch Frau Hedda Gehm, Referentin und stellvertretende Referatsleiterin im Referat Allgemeine Kunstförderung des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst.
Als langjährige Sammlerin ist Frau Gehm Expertin für Belutsch-Teppiche.
- Siehe auch:
|